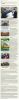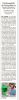Die Artikel im Pressearchiv stammen - soweit nicht anders gekennzeichnet - aus dem HarzKurier, Tageszeitung aus dem Landkreis Göttingen (ehemals Landkreis Osterode am Harz)
2026
2025
Zum Artikel: Das Industriedenkmal in Bad Lauterberg aus dem HarzKurier - er ist leider schlecht lesbar
Harzkurier, 17. Juli 2025
Das Industriedenkmal in Bad Lauterberg
Der Lerbacher Modelleur Reissner brachte die Kunstgießerei zu hohem Ansehen
Bad Lauterberg/Lerbach. Das Südharzer Eisenhüttenmuseum Königshütte in Bad Lauterberg wurde mit dieser Namensgebung im Jahr 1733 gegründet.
Die Spuren der Geschichte sind nicht verloren, weil am 3. Dezember 1983, vor über 40 Jahren, der Förderkreis gegründet wurde. Die Initiatoren waren Dr. Ing. Hans-Emil Kolb aus Clausthal und Studiendirektor Hans-Heinrich Hillegeist aus Göttingen. Der Förderverein hat 1986 das gesamte Königshütten-Ensemble unter Denkmalschutz stellen lassen.
Als „Kulturerbe von nationaler Bedeutung“ wurde das Südharzer Eisenhüttenmuseum eingestuft und nach intensiver zehnjähriger Arbeit an Gebäuden und Bauniveau am 11. September 1998 eingeweiht.
Der Förderkreis lädt zu Führungen ein
Von Mai bis Oktober finden Dienstagnachmittags ab 15 Uhr Führungen mit wirtschaftlichem Rundgang durch das gesamte Ensemble mit Einblick in die Gießhalle und Maschinenfabrik statt. Auch zählt zur Öffentlichkeitsarbeit der jährlich stattfindende Internationale Museumstag im Mai.
Aus dem Nachlass von Modelleur Friedrich Reißner wurden 2006 u.a. Exponate vom Oberharzer Bergwerksmuseum in Zellerfeld übernommen. Der Autor hat nachfolgend eine Biographie von Reißner erstellt.
Biographie von Friedrich Reißner * 1880 †1966
Im Bergdorf Lerbach ist im Kirchbuch – Seelenregister – erstmalig ein Hermann, Murat Reihsner geb. 1808 in Wieda am Harz notiert. Er ist mit Ehefrau geb. Ahrenhold verheiratet und war vorher in Altenau Hüttenmann. Beide sind nach der Goldenen Hochzeit 1890 in Lerbach verstorben.
August Friedrich Carl Reißner wurde am 15. August 1880 als Sohn des Formers Friedrich August R. und dessen Ehefrau Christiane Henriette Friederike, geb. Haeger in Lerbach geboren und am 5. September 1880 getauft. Er absolvierte von April 1895 bis März 1899 als Modelleur eine Lehre in der im Jahr 1879 erbauten Königlich-kurfürstlichen-braunschweigisch-lüneburgischen Eisenhütte in Lerbach. Nach der Lehrzeit ernannte ihn das Hüttenamt zum Modelleur-Gesellen. Die Eisenhütte wurde nach kurzer Stilllegung 1837 neu erbaut. Lerbach kam 1885 zum preußischen Landkreis Zellerfeld.
Reißner heiratete am 6. Mai 1910 die aus der Ortschaft Freiheit stammende Sophie Anna Pöhler (geb. 9.11.1882). Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, Friedrich, gab 12. Mai 1911 und Wilhelm geb. 3. November 1920. Beide Söhne wurden in Gleiwitz/Oberschlesien geboren und Wilhelm zog 1953 nach Badenhausen. Im Osteroder Kreisanzeiger erschien am 30.08.1980 ein Artikel anlässlich seiner Versetzung in den Ruhestand.
„Nach über 40 Jahren Schuldienst in der Grundschule Badenhausen wurde Wilhelm Reißner im August 1980 in den Ruhestand verabschiedet. Als Pädagoge und mit zahlreichen Ehrenämtern, u.a. als Kreisheimatpfleger und für sein Hobby Archäologie und Heimatforschung wurde Dank und Anerkennung ausgesprochen.“
Am 1. September 1908 wurde Reißner als Modelleurgehilfe auf der Gleiwitzer Hütte eingestellt. Mit Wirkung von 1. Dezember 1910 erhielt er „im Namen des Königs“ seine Ernennungsurkunde zum Königlichen Modelleur und mittleren Werkbeamten. Die Vorfahren Reißners und auch Haeger (Großeltern mütterlicherseits) waren eng mit den Eisenhütten im hannoverschen Harz verbunden, u.a. Administration Altenauer und Lerbacher Hütte. Was verschlug Reißner nach Oberschlesien? Diese Frage beantwortet der Autor über einen Harzer aus Altenau, den es auch nach Gleiwitz verschlug:
Am 4. März 1884 nahm Carl Julius Wilhelm Meine als Sohn des Formers Carl Meine seine Tätigkeit in Gleiwitz auf. Meine wurde am 27. Januar 1859 als Sohn des Formers Carl Meine in Altenau geboren.
Seit 1873 arbeitete Carl Meine jun. Als Lehrling, dann als Former und Modelleur auf der Eisenhütte Lerbach, die 1866 preußisch geworden war. Während seiner Tätigkeit in Gleiwitz stellte Meine in seinen Mußestunden die alten Kunstgüsse und Modelle in einem kleinen Museum zusammen und ergänzte schadhaft gewordene Modelle. In kleinem Umfang wurden einige Formen in Zink nachgegossen. Meine selbst blieb nicht ganz untätig und erreichte bei der Hüttenverwaltung, dass er durch eigenen Schöpfung zu einer Wiederbelegung des Eisenkunstgusses beitragen durfte. So entstand bei ihm eine Nachbildung des Reden-Denkmals in Königshütte, ein Georgsmedaillon, ein Medaillon mit dem Brustbild der Königin Luise, ein Zierteller zur Gedenkfeier des 150jährigen Bestehens der Malapaner Hütte mit der Kettenbrücke, eine lebensgroße Büste des Bergrates Jüngst und eine Plakette des Wappens von Beuthen. Mit dieser künstlerisch wohl nicht so überaus bedeutenden Arbeiten wurde noch eine Wiedereröffnung einer eigenen Kunstgussabteilung im Hüttenwerk Gleiwitz erreicht. Bedingt durch langanhaltende Krankheit sah sich Meine gezwungen, am 1. Oktober 1908 in den Ruhestand zu treten. Sein Nachfolger wurde Friedrich Reißner.
1908: BiksmarkBerufliche Meilensteine mit Denkmälern und Reliefs
Reißner erhielt Zeichenunterricht bei Professor Riegelmann und Professor Havenkamp in Berlin, wo er auch bei Prof. Schäfer du Prof. Hans Virchov anatomische Kenntnisse erwarb. In dieser Stadt führte Reißner im Weißen Saal des ehem. Königl. Schlosses und im Herrenhaus größere Modellarbeiten aus. Am Ende des Jahres 1910 wurde Reißner dann königlicher Modelleur und Leiter der Kunstgießerei zu Gleiwitz. Mit sehr großem Engagement machte er sich an die vorhandenen Modellvorräte, dabei mussten manche fehlenden Teile rekonstruiert werden. Nebenbei erweiterte er sein Wissen um die in Vergangenheit geratenen Abformungsmethoden sowie um die Gieß- und Färbungsrezepte. Hilfskräfte mussten für die bei Kunstguss unerlässlichen Ciselierarbeiten geschult werden. Nun ging es nicht allein um das Wiederentstehen der alten Kunstgussartikel. Dieses bildete nur eine Seite seiner beruflichen Aktivitäten. Schon bevor die Öffentlichkeit durch ein 1915 versandtes Preisverzeichnis über Kunstguss starkes Interesse an diesen Zierstücken bekundetet, wurde Reißner ermuntert, den überlieferten Modellen eigene Modellschöpfungen zur Seite zu stellen. In dem Buch von Erwin Hintze: „Gleiwitzer Eisenkunstguß“ werden folgende Arbeiten von Friedrich Reißner aufgeführt:
1909: Bismarckrelief. – 1909: Bismarckbüste. – 1910 Nachbildung des Standbildes Friedrichs des Großen von Uhlenhut im Regierungsgebäude in Oppeln. Nachbildung eines Teiles von Thorwaldsens Alexanderzug in der Villa Carlotta am Comer See. – 1911: Jahn-Medaillon für das Turnerdenkmal in Lerbach. Bildnisplakette des Oberbergrates Arns. – 1912 Schillplakette zum Schilldenkmal in Sodow. Medaillons Friedrichs des Großen und Kaiser Wilhelm II. für das Denkmal der Friedrichsgrube in Tarnowitz. - - 1913: Keithplakette für das Keithdenkmal in Gleiwitz. – 1919: verschiedene Gedenktafeln für Kriegerdenkmale. – 1924 – 1927: durchbrochene, in ihrer Art in Gleiwitz etwas Neues bietende Reliefs: Hänsel und Gretel, tapferes Schneiderlein, tanzende Kinder, Man im Mond, Münchhausen, Hexentanz, Hans im Glück, Eulenspiegel, Dorfmusiker und Hofmusikanten, Bücherwurm, Rokokozeit, Ansichten der Schrotholzkirchen von Gleiwitz, Alt-Berun und Radkzeow. - 1927: Hindenburgplakette.
1925 schuf der Modelleur Friedurch Reißner zwei Familienbildnisse, die in Gleiwitz in Eisen gegossen wurden: Bildnis seiner Frau Sophie und das Bildnis seines Sohnes als fünfjährigen. Mit diesen Medaillons mit Profilbildnissen reihte sich Reißner ein in die alte Tradition des Gleiwitzer Eisenkunstgusses. In der Zeit der schweren Wirtschaftskrise schied Friedrich Reißner aus der Kunstgießerei zu Gleiwitz aus und kehrte mit seiner Familie nach Osterode zurück. Sein Versuch im Jahr 1931, über den Leiter des schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer, Prof. Dr. Erwin Hintze, wieder eine Arbeitsstelle zu bekommen, hatte nicht den erwünschten Erfolg.
Bis zu seinem Tod wohnte er wieder in seiner Harzheimat Osterode und verstarb 1986 im 86. Lebensjahr.
Medaillon am Jahn-Denkmal in Lerbach
Der Autor beendet seinen Artikel mit Blick von seinem Wohnhaus Fr.-Ebert-Straße 69 auf das Denkmal zu Ehren von Turnvater Friedrich Ludwig Jahn. Das Denkmal wurde am Pfingstsonntan, 5. Juni 1911 eingeweiht. Auf dem drei Meter hohen Gedenkstein befindet sich ein Medaillon vom Turnvater und die Initialen F. Reißner sind noch gut lesbar.
Bleibt noch zu ergänzen, dass unterhalb vom Medaillon die Buchstaben F. L. Jahn eingemeißelt sind und darunter eine runde Eisenplatte (40 cm Æ) angebracht sind, die die vier F mit „Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei“ mit einem Eichenkranz enthält. Auf dem Steinsockel ist eine Eisenplatte (60 x 35 cm)angebracht, die auf die Einweihung hinweist und die Inschrift: „Lerbach’s Turner ihrem Turnvater 1811 – 1911“ enthält.
Anmerkung zum Artikel:
Der Artikel ist auch in dem Buch ‚‘ Rainer Kutscher – Eisenhüttenwerke und Gießereien‘ zu finden, in dem Buch geht es um die Königliche Eisenhütte Lerbach, die Gelbgießerei Schubert und Karnebogen, die Metallgießerei E. Heine, Nachfolger, die Eisengießerei Ernst Müller, Freiheit und die Königshütte Lauterberg
Leider enthält der Artikel ein paar Fehler, Herr Hillegeist, jetzt Ehrenvorsitzender, hat diese berichtigt. Dieses ist der Text aus dem Harzkurier vom 6. August 2025
Eisenhütten im Harz – 7 Fakten über die Königshütte in Bad Lauterberg
Bad Lauterberg. Hans-Heinrich Hillegeist ist ein Experte, was die Königshütte in Bad Lauterberg angeht. Hier verrät er 7 Details über das Ausflugsziel.
- Gerüchte um den Hüttenbrunnen
Der gusseiserne Brunnen mitten auf dem Gelände der Königshütte ist heute eines der Wahrzeichen des Ensembles. Er wurde samt Gitter, der Säule und den beiden Schalen in den Jahren 1850 und 1851 hergestellt. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass dieser Brunnen 1889 für die Weltausstellung in Paris gegossen worden ist. Es lässt sich laut Förderkreis jedoch nicht belegen, dass der Brunnen je auf einer Weltausstellung ausgestellt worden ist.
- Das größte hannoversche Eisenhüttenwerk im 18. Jahrhundert
Die Königshütte wurde in den Jahren 1733 bis 1737 erbaut, also zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Einige der wenigen Hüttengebäude stammen sogar noch aus der ersten Bauperiode um 1733. Sie war das größte Eisenhüttenwerk im hannoversche Staat. Die Produkte, beispielsweise Gussteile für den täglichen Gebrauch oder Ofenbauteile sowie Draht, wurden weit über die Grenzen des Harzes hinaus vertrieben.
- Eisenhüttenmuseum seit 1997
Heute befindet sich auf dem Gelände der Königshütte ein Eisenhüttenmuseum. Diese wurde am 11. September 1997 eingeweiht. Das Museum soll Besucherinnen und Besucher die Grundlagen der Eisenverhüttung vermitteln. Man erhält aber auch Eindrücke von Produkten der Hütte (Öfen, Erzeugnisse des Eisenkunstgusses), Bodenschätzen im Harz und der Harzer Wasserwirtschaft.
- Kulturerbe von nationaler Bedeutung
Das ganze Hüttenensemble gilt seit Oktober 2014 als Kulturerbe von nationaler Bedeutung, weil es einst ein wichtiger Standort für die Eisenverarbeitung im Harz war und die Erinnerung daran noch heute lebendig hält und soll Besucherinnen und Besuchern zugänglich macht. Sie zeigt den technischen Fortschritt der damaligen Zeit, insbesondere in den Bereichen Hochofenbetrieb, Gießereitechnik und Drahtziehen.
- Teilnahme am Tag des offenen Denkmals
Der Förderkreis lädt ein zu Führungen: von Mai bis Oktober finden diese jeden Dienstag statt, von November bis April im zwei-Wochen-Rhythmus an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Hüttenbrunnen. Zusätzlich nimmt der Verein jedes Jahr am Internationalen Museumstag und am Tag des offenen Denkmals teil.
- Exponate vom Lerbacher Modelleur auf der Königshütte
Im Besitz des Förderkreises befinden sich Exponate des Modelleurs Friedrich Reißner aus Lerbach. Zu seinen Arbeiten soll das 1911 gegossene Jahn-Medaillon für das Turnerdenkmal in Lerbach gehören. Vorfahren sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits sollen auf Eisenhütten im hannoverschen Harz tätig gewesen sein, z.B. Altenau und Lerbach.
- So kommt ein Modelleur aus dem Harz nach Oberschlesien
Friedrich Reißer wirkte zu seinen Lebzeiten nicht auf der Königshütte im Harz, sondern in der Gleiwitzer Hütte in Oberschlesien. Er war dort der Nachfolger eines anderen Harzers: Carl Julius Wilhelm Meine aus Altenau. Einen ausführlichen Bericht über Meine und Reißner veröffentlichte Hans-Heinrich Hillegeist im Allgemeinen Harzer Bergkalender für das Jahr 1985 unter dem Titel „ Harzer Modelleure belebten den Gleiwitzer Kunstguss.“ Hillegeist gehörte im Jahre 1983 zu den Gründern des Förderkreises Königshütte.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007